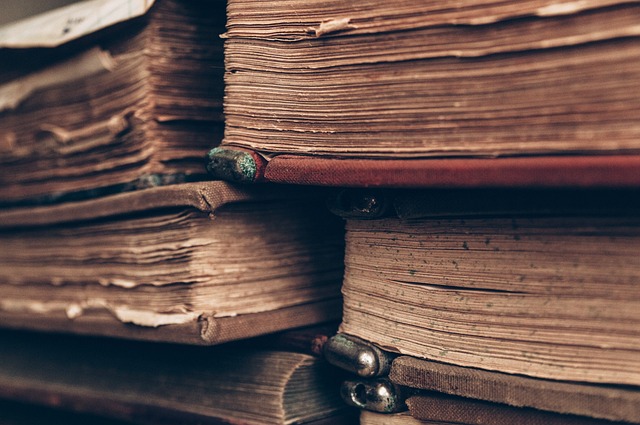Ein psychisches Symptom (z.B. Depression, Ängste etc.) ist ein Zeichen einer psychischen Dekompensation, d.h. die psychischen Fähigkeiten reichen zur Bewältigung der aktuell anstehenden Lebensaufgaben nicht mehr aus – die Psyche des Menschen ist überfordert.
Die psychischen Fähigkeiten zur Bewältigung der Lebensaufgaben erlernen wir idealerweise während unserer Kindheit und Adoleszenz. Aus verschiedensten Gründen kann es passieren, dass dieses nicht in ausreichendem Maße gelingt. Diese Entwicklungsdefizite können die meisten Menschen eine ganze Weile kompensieren – bis irgendwann die Fähigkeiten nicht mehr ausreichen, um die Anforderungen des Lebens zu erfüllen. Es kommt zur Dekompensation, die sich in psychischen Symptomen zeigt.
An dieser Stelle ist es also wichtig, etwas zu verändern.
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert.
Albert Einstein
In der Psychotherapie versucht man herauszufinden, welche Fähigkeiten fehlen, um sie anschließend mit Hilfe des Therapeuten zu erlernen. Es findet dadurch ein Nachreifen statt und die Symptome werden deutlich weniger oder verschwinden sogar ganz.
Psychotherapie ist verstehen und lernen.